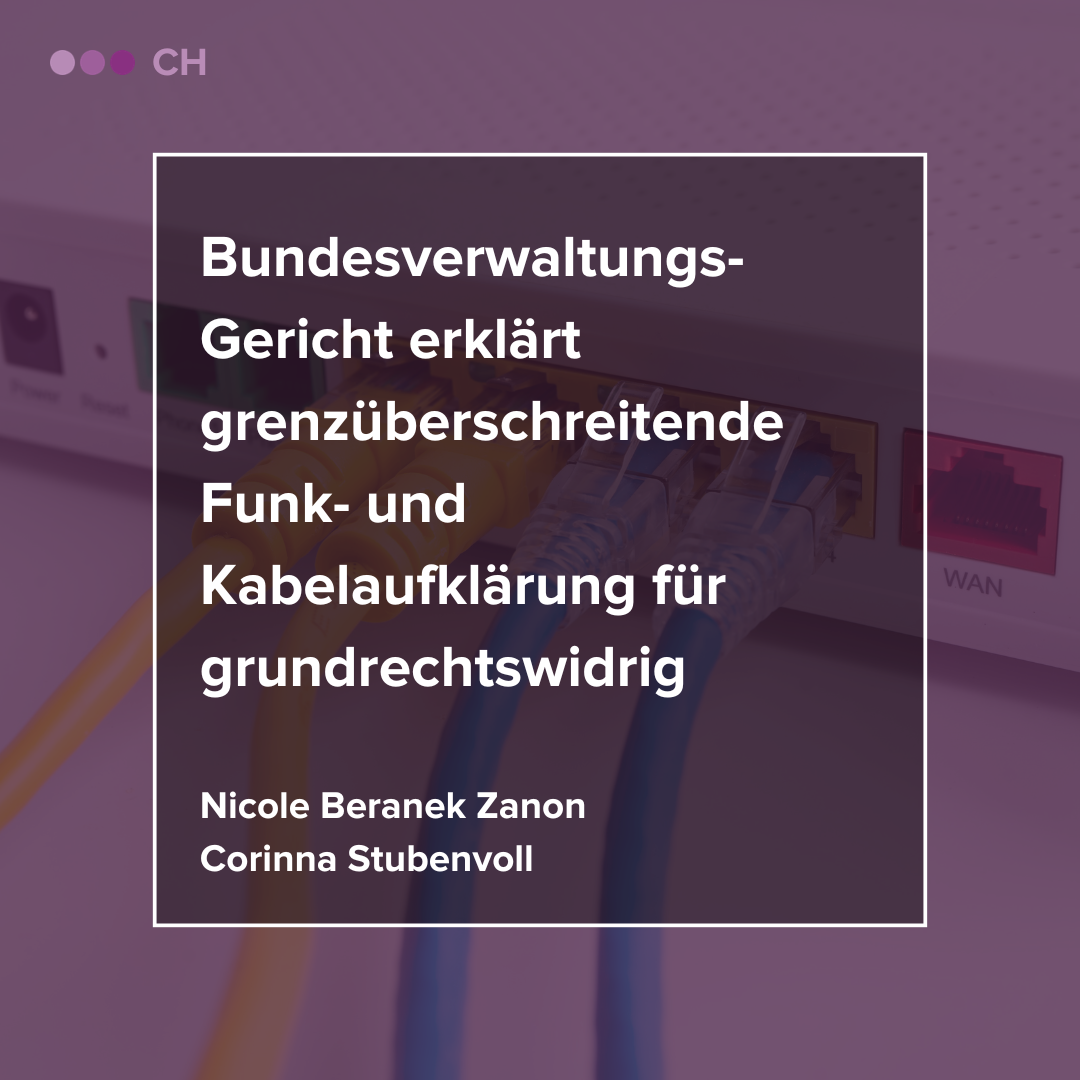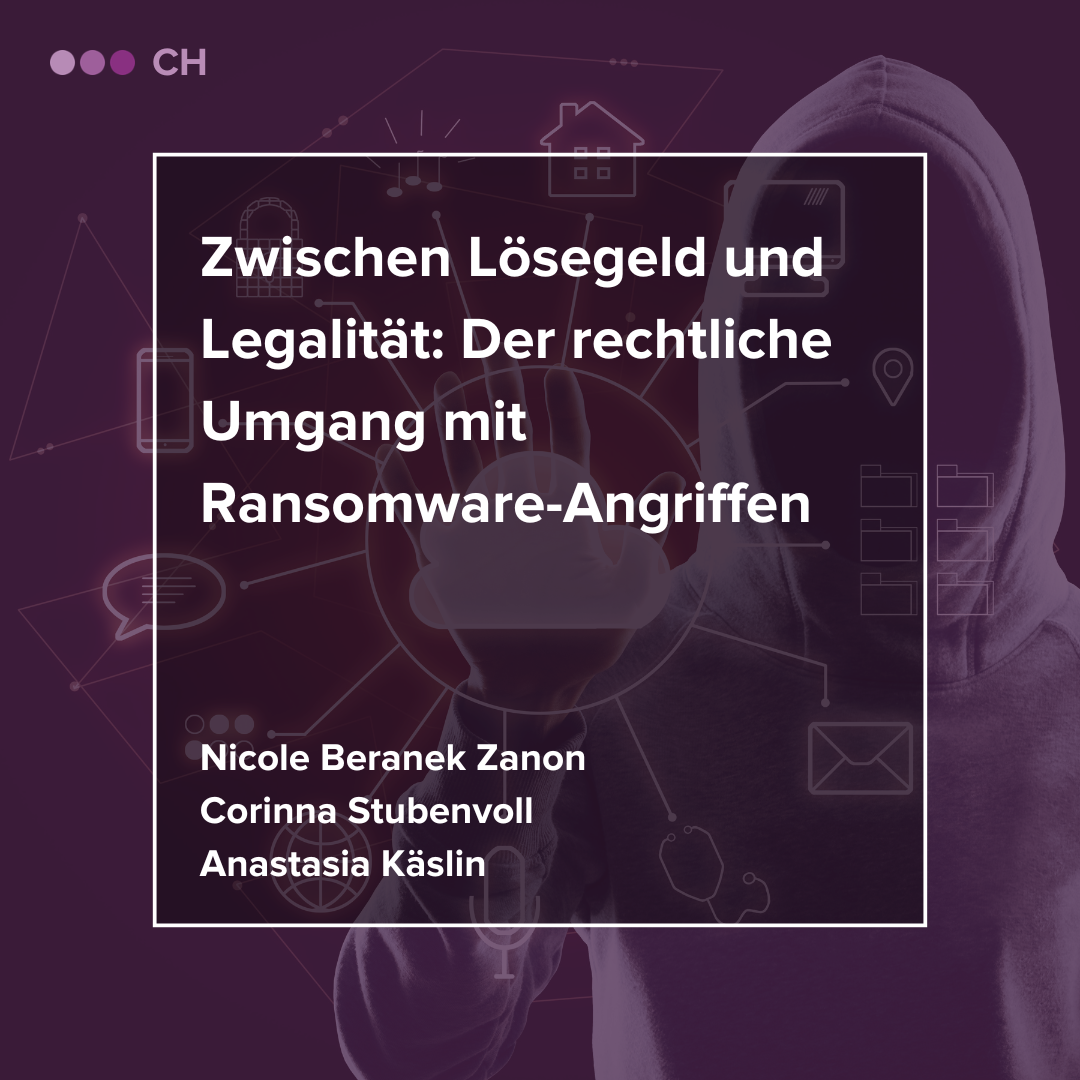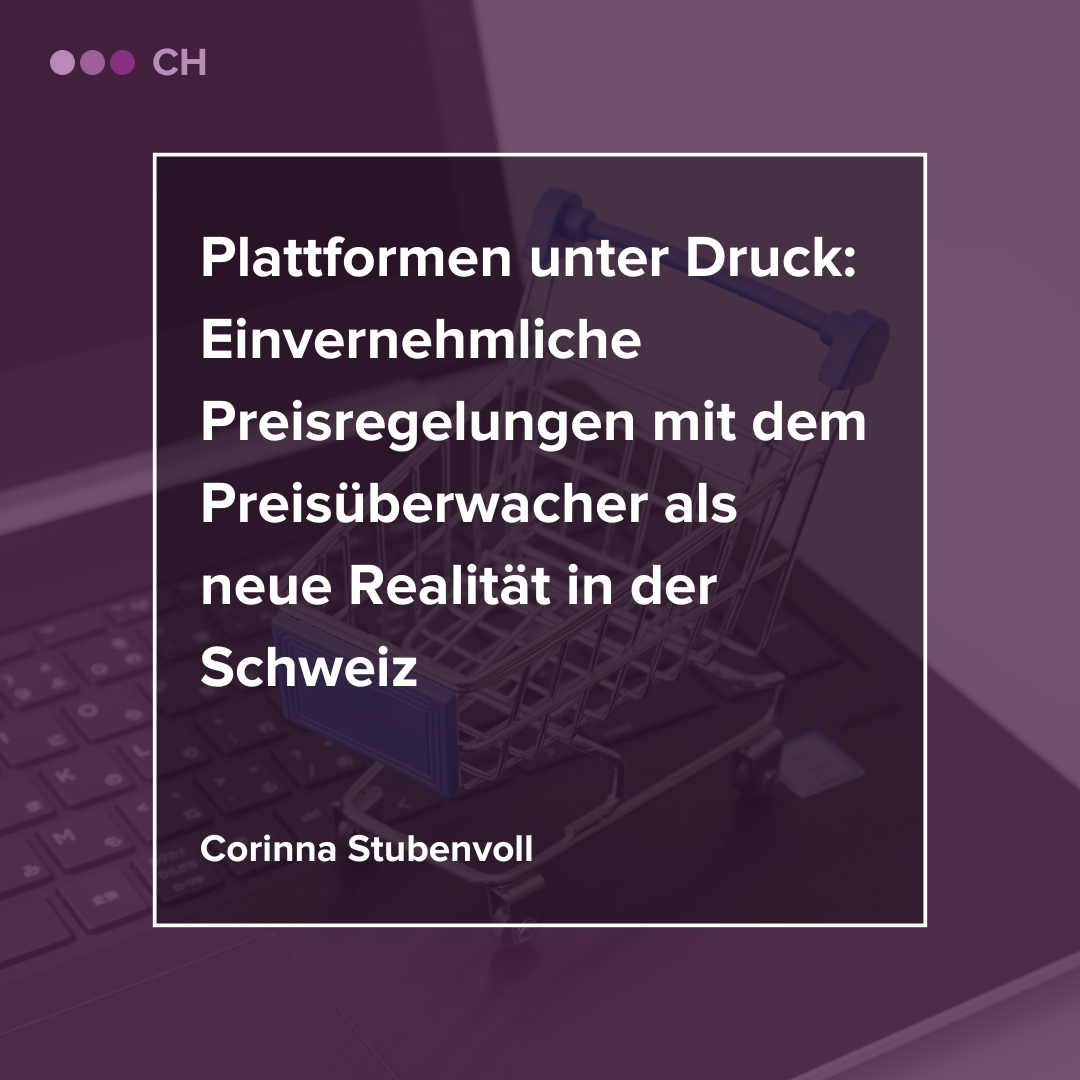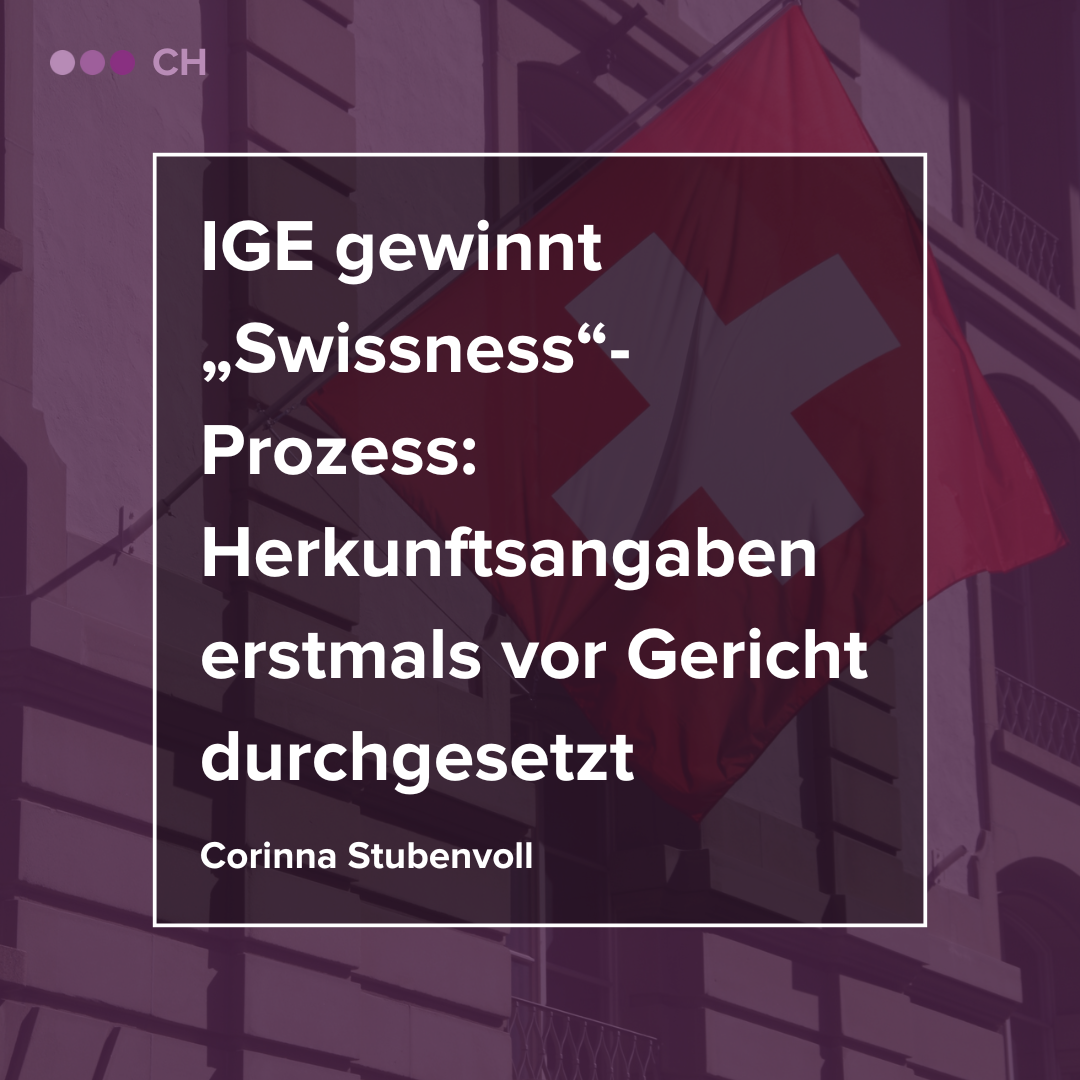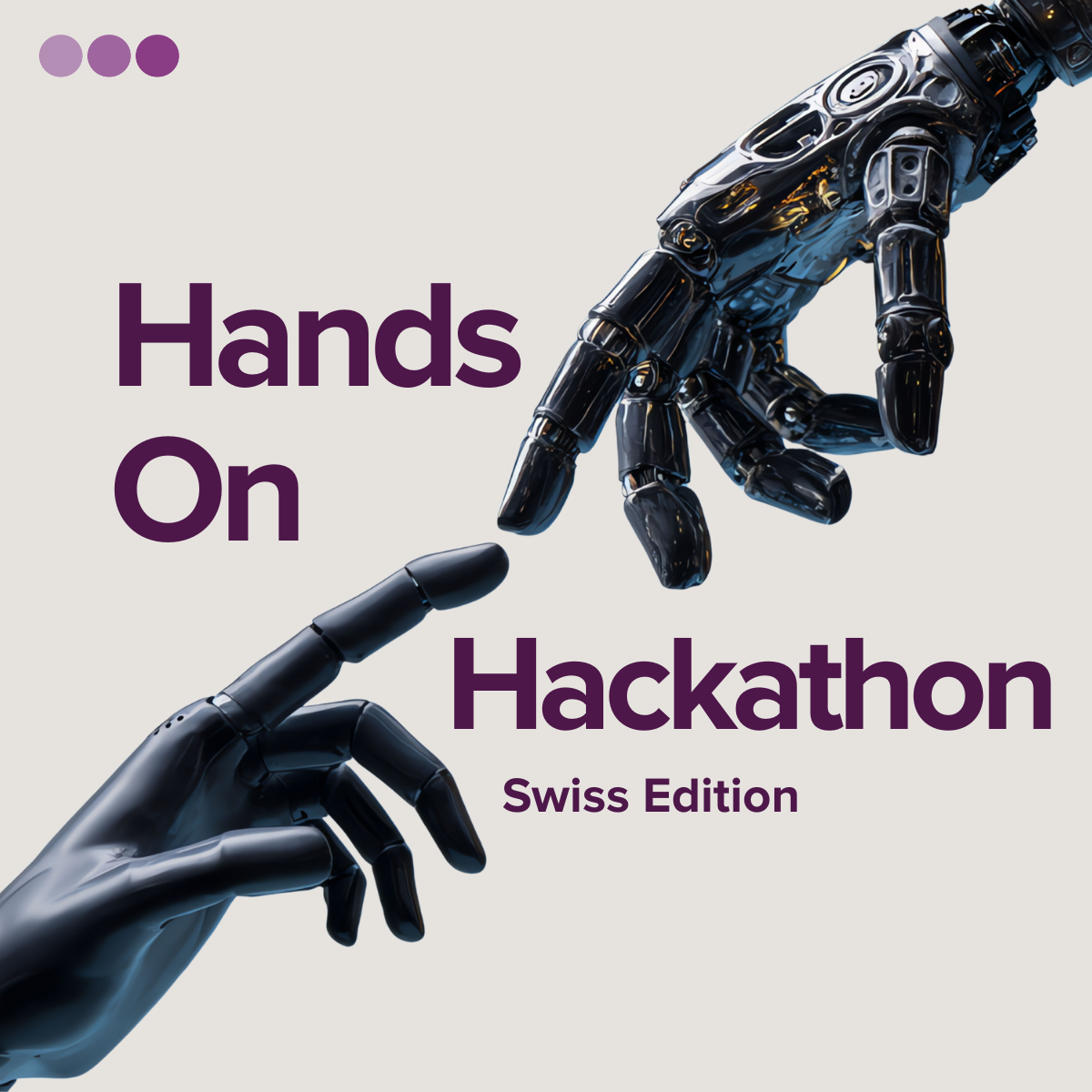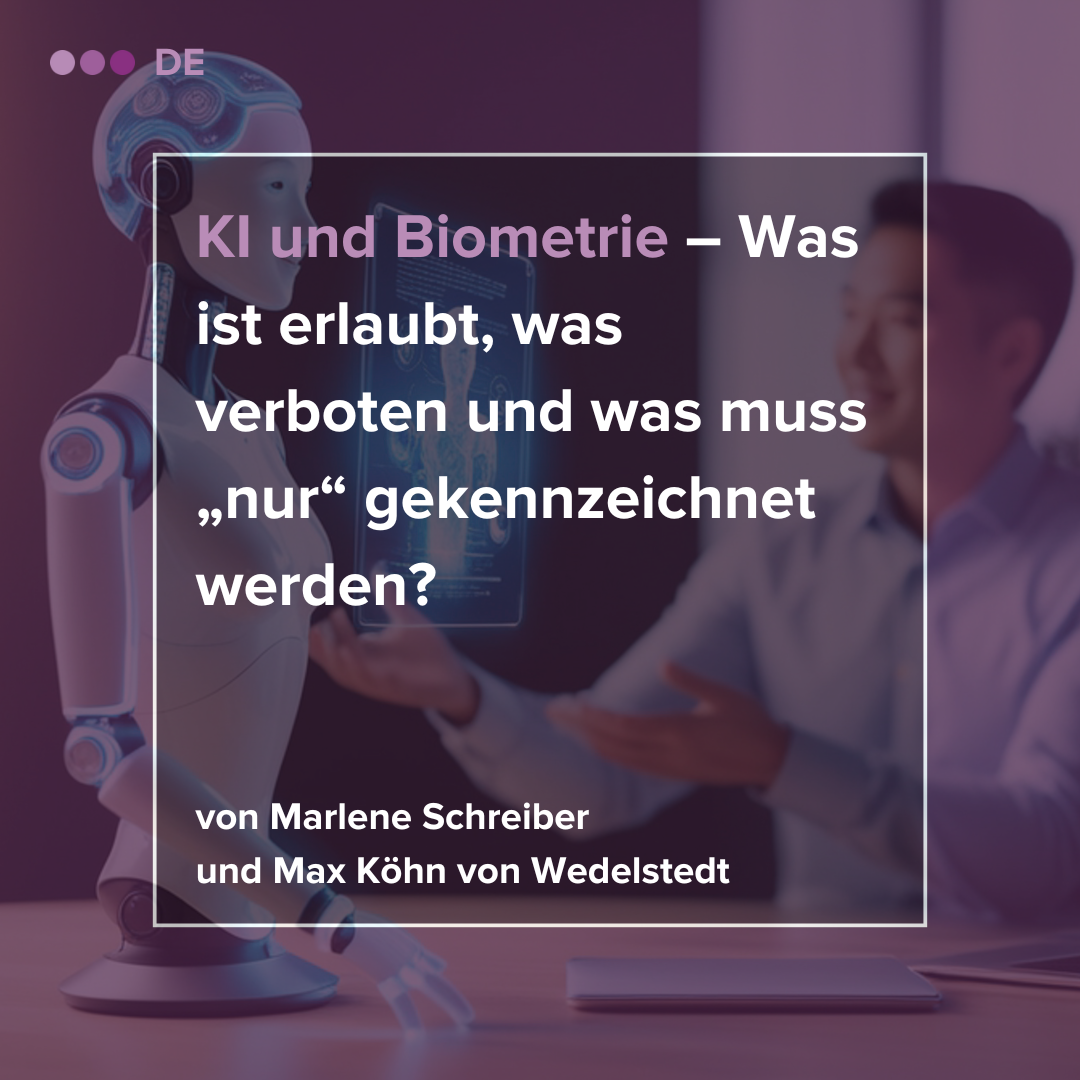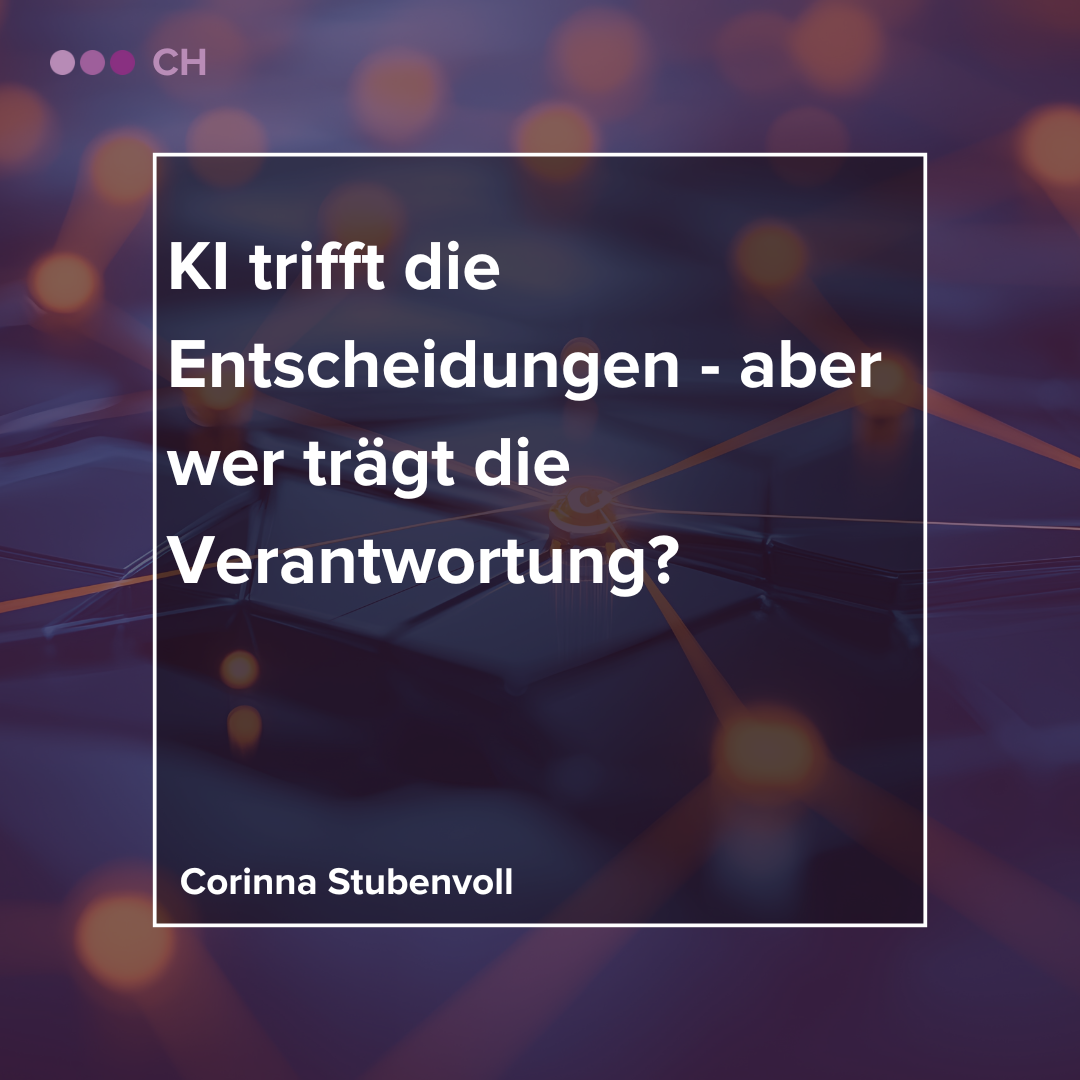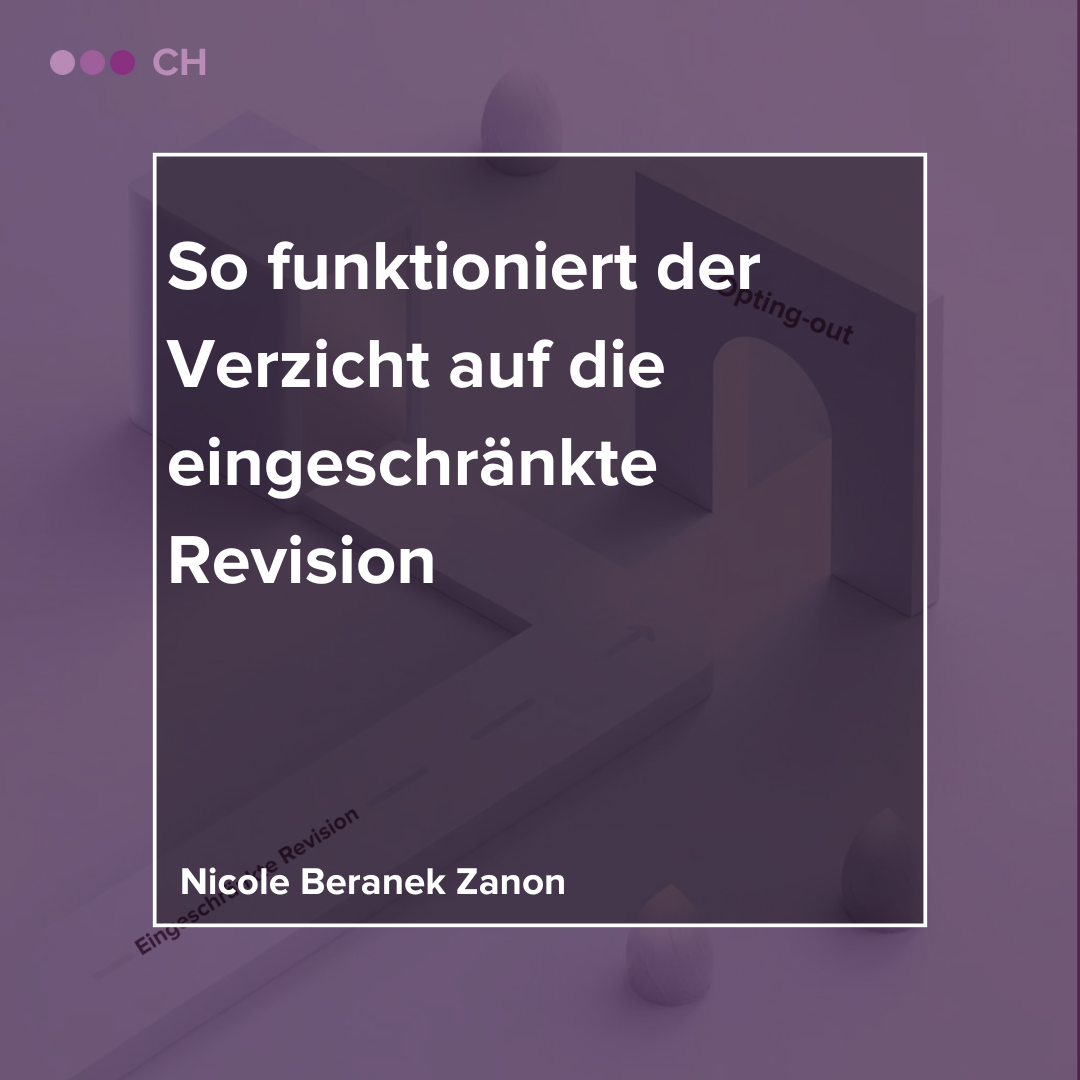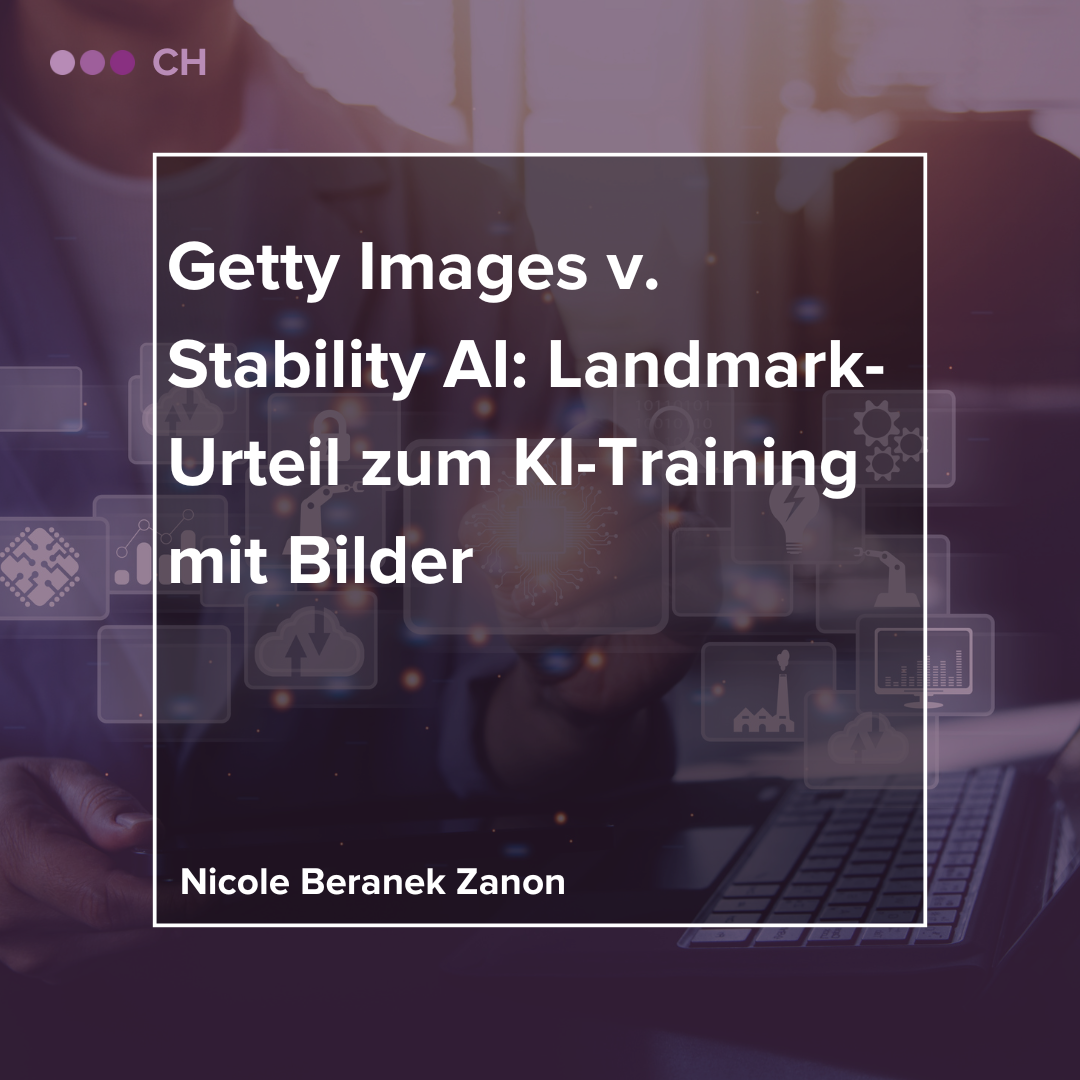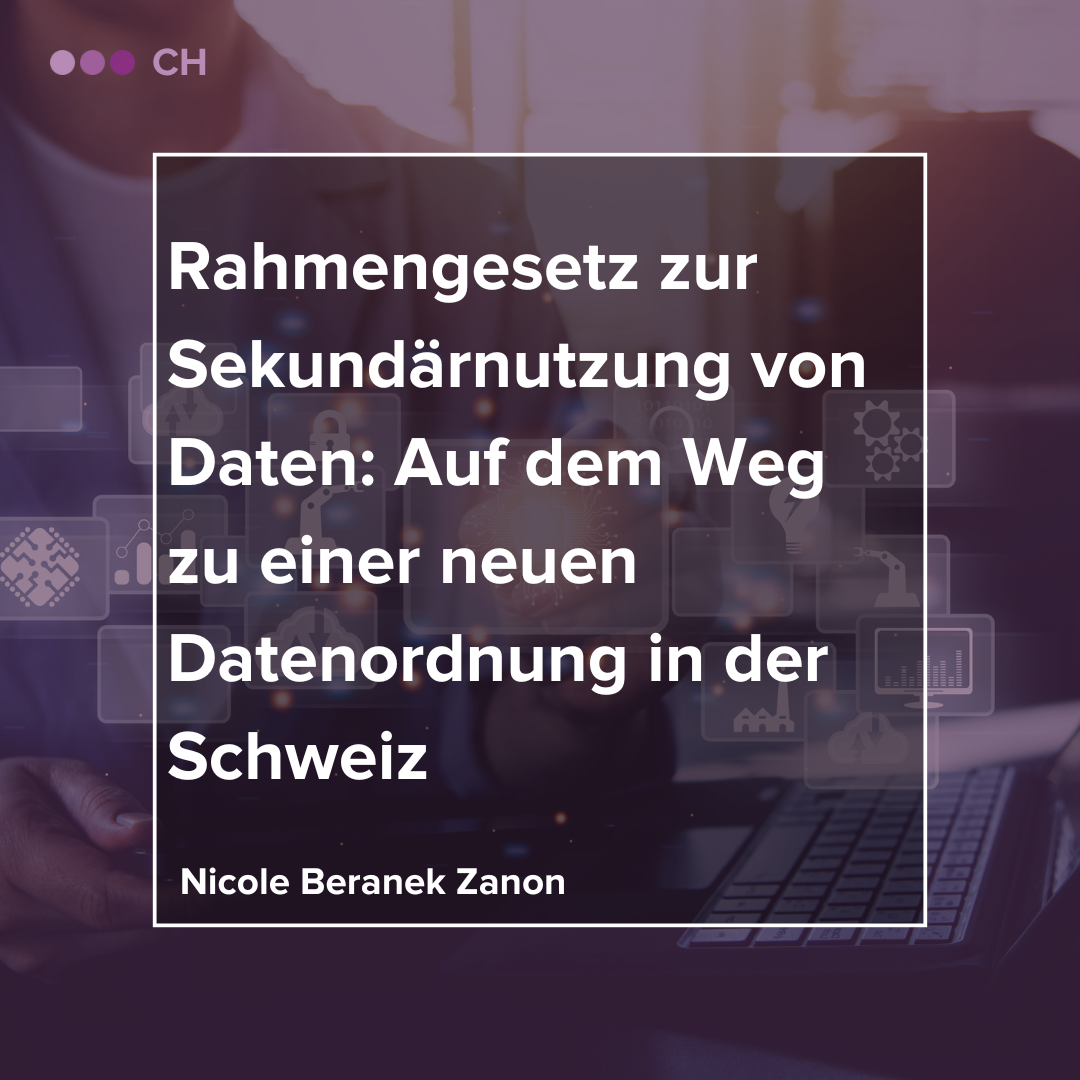Bundesverwaltungsgericht erklärt grenzüberschreitende Funk- und Kabelaufklärung für grundrechtswidrig
Das Bundesverwaltungsgericht erklärt die grenzüberschreitende Funk- und Kabelaufklärung des Nachrichtendienstes für grundrechtswidrig. Die strategische Massenüberwachung grenzüberschreitender Kommunikation verstösst gegen Bundesverfassung und EMRK – jedenfalls in ihrer heutigen Ausgestaltung. Der Gesetzgeber erhält fünf Jahre Zeit zur Korrektur. Was bedeutet das für Unternehmen, Medienschaffende und die digitale Sicherheit in der Schweiz?